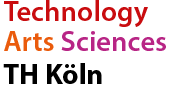Von Laura Seidelmeyer.
Der Beitrag wurde im Rahmen des Moduls 6 – Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung – im Masterstudiengang Versicherungsrecht an der TH Köln im Oktober 2025 erstellt.
Einleitung: Ein ganz alltäglicher Unfall – oder doch nicht?
Die private Haftpflichtversicherung gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Sicherheitsnetzen des Alltags. Sie schützt vor finanziellen Folgen, wenn man versehentlich das Eigentum anderer beschädigt oder einen Mitmenschen verletzt. Doch wie belastbar ist dieses Netz wirklich? Wann greift die Privathaftpflicht tatsächlich, wo verlaufen die Grenzen zu anderen Produkten? Welche Risiken sind vom Schutz ausgeschlossen – und warum?
Die Antworten darauf sind nicht nur für Betroffene relevant, sondern auch für die Weiterentwicklung des Versicherungsrechts und seine praktische Anwendung.
Dieser Beitrag nimmt einen aktuellen Fall[1] aus der österreichischen Rechtsprechung zum Anlass, die wissenschaftlichen Grundlagen, die Dogmatik und die praktische Bedeutung der Ausschlussklauseln für Kraftfahrzeugrisiken in der Haftpflichtversicherung näher zu beleuchten. Im Fokus steht dabei auch die Frage, wie nationale Unterschiede das Ergebnis beeinflussen können.
Der Sachverhalt: Wer zahlt nach dem Unfall im Reisebus?
Unser Protagonist, nennen wir ihn Herrn P., war als Passagier in einem Reisebus unterwegs. Als er während der Fahrt aufstand, um die Toilette zu benutzen, musste der Fahrer plötzlich eine Vollbremsung machen. Herr P. wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert, die dabei zu Bruch ging, der Busunternehmer forderte Schadensersatz. Herr P. wandte sich an seine Privathaftpflichtversicherung, doch diese verweigerte die Leistung mit Verweis auf eine Ausschlussklausel für Schäden aus der „Verwendung von Kraftfahrzeugen“.
Herr P. fühlte sich ungerecht behandelt, denn schließlich hatte er den Bus nicht gelenkt, sondern war nur Passagier. Das Erstgericht sah das ebenso und gab ihm Recht. Doch das Berufungsgericht und der OGH entschieden anders.
Die Entscheidung des OGH: Was heißt „Verwendung“ eines Kraftfahrzeugs?
Die zentrale Rechtsfrage lautete: Fällt Herr P.s Verhalten unter den Ausschluss der Privathaftpflichtversicherung für Schäden aus der „Verwendung von Kraftfahrzeugen“ nach Art. 7.5.3 AHVB 2003?
Die Klausel: „Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die der Versicherungsnehmer oder die für ihn handelnden Personen verursachen durch Haltung oder Verwendung von … 5.3 Kraftfahrzeugen (…).“
Die Argumente des OGH:
- Weite Auslegung des Begriffs „Verwendung“:
Der OGH stellte klar, dass „Verwendung“ nicht nur das aktive Fahren eines Kraftfahrzeugs meint, sondern auch das Mitfahren als Passagier. Entscheidend sei, ob sich ein typisches Risiko des Fahrzeugbetriebs verwirklicht habe. Die Bremsung und die daraus resultierende physikalische Kraft seien typische Betriebsgefahren eines Fahrzeugs. - Kausalität und Betriebsrisiko:
Der Schaden an der Windschutzscheibe entstand unmittelbar durch die starke Bremsung und die Bewegung des Fahrzeugs. Das Risiko, bei einer Vollbremsung verletzt zu werden oder Schäden zu verursachen, ist ein klassisches Betriebsrisiko eines Kraftfahrzeugs – und kein allgemeines Lebensrisiko. - Zweck der Ausschlussklausel:
Die Ausschlussklausel soll die erhöhte Gefahr, die von Kraftfahrzeugen ausgeht, aus dem Schutzbereich der privaten Haftpflichtversicherung ausklammern. Denn diese umfasse ausschließlich Schadensersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Privatperson, Risiken darüber hinaus und in Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen sollen ausschließlich der Kfz-Haftpflichtversicherung zugeordnet werden, insbesondere in dem Fall, in dem zwei Haftpflichtversicherungsverträge vorliegen. - Deckungslücke zwischen KFZ- und Privathaftpflicht:
Der OGH erkennt zwar an, dass es in solchen Fällen zu Deckungslücken kommen kann, weil die KFZ-Haftpflichtversicherung nur Schäden Dritter abdeckt. Dennoch sei die vertragliche Vereinbarung bindend – die PHV haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung eines Kraftfahrzeugs resultieren. Die Rechtsprechung bemühe sich bei der Auslegung der Versicherungsbedingungen, den Deckungsschutz so abzugrenzen, dass sie nahtlos ineinandergreifen, also sich weder überschneiden noch eine Deckungslücke hinterlassen. Dabei handele es sich jedoch lediglich um ein Auslegungsprinzip, nicht jedoch um einen zwingenden Rechtssatz.
Ergebnis:
Herr P. hatte Pech: Die Privathaftpflichtversicherung muss nicht zahlen, weil der Schaden aus der „Verwendung“ des Busses als Kraftfahrzeug entstand.
Blick nach Deutschland: Wäre das Urteil auch hier so ausgefallen?
Auch die Musterbedingungen des GDV[2] regeln in A1-7.14 PHV Ausschlüsse für Schäden im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen (sog. „Benzinklausel“).
Die deutsche Klausel: „Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.“
Es ergeben sich zwei zentrale Unterschiede im Vergleich zu der österreichischen Klausel:
- „Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs“
Anders als die österreichischen Bedingungen fordert der Ausschluss in den deutschen Musterbedingungen das Vorliegen einer bestimmten Eigenschaft, nämlich solche als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs.[3] Im vorliegenden Fall erfüllt Herr P. jedoch keine dieser Eigenschaften – er ist schließlich nur Mitfahrer. Der Katalog ist abschließend, denn wie sollte der durchschnittliche VN sonst wissen, in welchen Fällen der Versicherungsschutz ausgeschlossen ist? Demnach greift der Ausschluss in Form der „Benzinklausel“ nicht und Herrn P. wäre in Deutschland, vorausgesetzt das jeweilige Versicherungsunternehmen hat sich der GDV Musterbedingungen bedient, somit wohl nicht der Versicherungsschutz versagt worden.
- Engerer Begriff „Gebrauch“:
Darüber hinaus verwendet die deutsche Klausel den Begriff „Gebrauch“. Deutsche Gerichte interpretieren den „Gebrauch eines Kraftfahrzeugs“ meist restriktiver als die österreichische „Verwendung“.[4] Zwar kommt es hierauf im vorliegenden Fall nicht an, da auf Herrn P. als Mitfahrer wie beschrieben keine der abschließenden Eigenschaften zutrifft. Sollte in anders gelagerten Fällen jedoch eine der Eigenschaften greifen, so ist zu fragen, ob sich eine Gefahr verwirklicht hat, die gerade dem Fahrzeuggebrauch eigen und diesem selbst und unmittelbar zuzurechnen ist.[5] Der Schaden muss daher dem Risiko ausgehend von dem Kraftfahrzeug näher sein als dem privaten Risiko.[6] Das Verhältnis zwischen KFZ- und Privathaftpflichtversicherung wird in der deutschen Literatur ausführlich diskutiert, insbesondere um Deckungsüberschneidungen zu vermeiden und keine ungewollten Deckungslücken zu schaffen.[7] Aus ebendieser Diskussion resultiert eine trennschärfere Differenzierung und im Falle der Benzinklausel eine versicherungsnehmerfreundlichere Auslegung, ob der Schaden durch die spezifische Betriebsgefahr des Fahrzeugs entstanden ist oder ob es sich um ein allgemeines Lebensrisiko gehandelt hat. Im Fall des Herrn P. hätte es sich wohl um ein allgemeines Lebensrisiko gehandelt und nicht um einen Schaden aus dem Gebrauch eines Fahrzeugs. Damit hätte wohl auch in diesem Aspekt bei unterstellter Einschlägigkeit die private Haftpflichtversicherung geleistet.
Ergebnis:
Insgesamt zeigt sich, Herr P. vor einem deutschen Gericht erfolgreicher gewesen wäre. Die „Benzinklausel“ setzt für den Haftungsausschluss präzise Eigenschaften wie Eigentümer, Halter oder Führer voraus und legt den Begriff „Gebrauch“ enger aus. Für Mitfahrer wie Herrn P. bleibt der Schutz der Privathaftpflicht in Deutschland somit in der Regel bestehen – selbst wenn ein Schaden im Zusammenhang mit einem Kraftfahrzeug entsteht. Die systematische Trennung von Fahrzeuggebrauch und allgemeinem Lebensrisiko sorgt dafür, dass alltägliche Missgeschicke nicht automatisch zum Ausschluss führen und gibt Versicherten in Deutschland ein Stück mehr Sicherheit im Alltag.
Fazit:
Der Fall des OGH zeigt, wie nahe sich das deutsche und österreichische Versicherungsrecht in den Grundsatzfragen stehen, etwa bei der Auslegung von AVB oder den Risikoausschlüssen. Sie zeigt aber auch, dass der Teufel im Detail steckt: Während das österreichische Recht durch eine weit gefasste Auslegung des Begriffs „Verwendung“ selbst Mitfahrer vom Schutz der Privathaftpflicht ausschließt, setzt das deutsche Recht mit der „Benzinklausel“ und dem Begriff des „Gebrauchs“ auf klar definierte Eigenschaften und eine restriktivere Interpretation. Dies führt zu einer deutlich versicherungsnehmerfreundlicheren Lösung für alltägliche Situationen wie jene von Herrn P. Unterm Strich bleibt: Das scheinbar Selbstverständliche kann zur juristischen Gratwanderung werden. Und das Kleingedruckte entscheidet, ob der Schutzengel der Haftpflichtversicherung tatsächlich einspringt.
[1] öOGH, Urt. v. 22.11.2023 – 7 Ob 194/23i; Volltext abrufbar unter BeckRS 2023, 37487.
[2] https://www.gdv.de/resource/blob/6242/1fe6d0497c64d06bd8aab00f1cf98fac/09-avb-fuer-dieprivathaftpflichtversicherung-avb-phv-gdv-2020-data.pdf (abgerufen am 23.10.2025)
[3] r+s 2024,259/2 Heft 6 (Schimikowski) = ZVR 2024/55 S 139
[4] vgl. Prölss/Martin/Lücke MB PHV Abs. 3 Ziff. 3 Rn. 10f
[5] BGH VersR 2007, 388
[6] Prölss/Martin/Lücke MB PHV Abs. 3 Ziff. 3 Rn. 10
[7] HK-VVG/Schimikowski AVB PHV A1-7 Rn. 21 mwN.