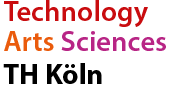Zur Abgrenzung von Kfz- und Betriebshaftpflichtversicherung
OLG Hamm, Beschluss vom 19.06.2023 – 20 U 76/23
Von Greta Hansen und Eva Nagel
I. Einleitung: Wenn der Staub sich legt
Es sind oft die unscheinbaren Fälle, die die großen Fragen des Versicherungsrechts aufwirbeln. So auch hier: Ein Silo-LKW, ein wenig Splitt, ein fehlender Wasseranschluss und am Ende ein Streit über die Reichweite einer Ausschlussklausel in der Betriebshaftpflichtversicherung.
Das Oberlandesgericht Hamm hatte mit Beschluss vom 19. Juni 2023 (20 U 76/23) über einen Klassiker des Zusammenspiels zweier Versicherungssparten zu entscheiden: Wann ist ein Schaden „beim Gebrauch“ eines Kraftfahrzeugs entstanden und wann nicht mehr?
Klingt banal? Keineswegs. Denn an dieser Abgrenzung hängt nicht weniger als die Frage, welcher Versicherer letztlich zahlt, der Betriebshaftpflicht- oder der Kfz-Haftpflichtversicherer.
II. Der Fall: Splitt, Staub und die Sache mit dem Schlauch
Der Sachverhalt liest sich wie ein juristischer Baustellenroman:
Ein Bauunternehmen sollte auf dem Hochdeck eines Parkhauses Pflasterarbeiten durchführen. Der hierfür benötigte Splitt wurde mit einem zugelassenen, kraftfahrthaftpflichtversicherten Silo-LKW angeliefert. Das Material wurde mittels der Motorkraft des Fahrzeugs und der auf dem Fahrzeug vorhandenen Vorrichtungen durch eine Schlauchleitung auf das obere Parkdeck eines Parkhauses gepumpt.
Diese Nutzung der Motorkraft des LKW stellt den entscheidenden Punkt des Falles dar: Gerade, weil die Motorleistung des Fahrzeugs zur Materialbeförderung eingesetzt wurde, wird der Vorgang als „bei Gebrauch des Fahrzeugs“ im Sinne der Kraftfahrthaftpflichtversicherung angesehen. Dies führte dazu, dass die Betriebshaftpflichtversicherung des Bauunternehmens ihre Eintrittspflicht unter Verweis auf den Ausschluss für Schäden „durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen“ (Ziffer 5.4.1 des Bedingungswerks) ablehnte und auf die Zuständigkeit der Kfz-Versicherung verwies.
Dummerweise war am Ende der Schlauchleitung der Wasseranschluss vergessen worden, sodass der eigentlich zügig geplante Entladevorgang in einer massiven Staubentwicklung endete. Das Resultat war ein erheblicher Gebäudeschaden und ein Streit um die Deckung.
Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen und das OLG Hamm sah keinen Anlass, daran zu rütteln. Die Berufung der Streithelferin (des Kfz-Versicherers) hatte nach Ansicht des Senats keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 S. 1 ZPO).
III. Der rechtliche Rahmen: Gebrauch, Betrieb und die Tücken der AVB
Die einschlägigen Besonderen Bedingungen zur Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (BBH) für das Bauhauptgewerbe sehen vor, dass die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Gebrauch von Kraftfahrzeugen grundsätzlich ausgeschlossen ist (Ziff. 5.4.1).
Eine Ausnahme gilt nur für nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit (Ziff. 4.9). Der hier verwendete Silo-LKW war jedoch – selbstverständlich – zulassungs- und versicherungspflichtig.
Die entscheidende Frage lautete daher:
Ist der Schaden „beim Gebrauch“ des Silo-LKW entstanden, oder handelte es sich um eine selbständige betriebliche Tätigkeit des Bauunternehmens?
Entgegen der mit der Berufungsbegründung vertretenen Ansicht der Klägerin kam es nach Auffassung des Gerichts gerade nicht darauf an, ob das schadenstiftende Ereignis dem „Betrieb“ des Fahrzeugs im Sinne des § 7 Abs. 1 StVG zuzuordnen ist. Maßgeblich ist vielmehr der Gebrauch des Kraftfahrzeugs im Sinne der Versicherungsbedingungen.
Die Klausel in Ziffer 5.4.1 der Besonderen Bedingungen knüpft nicht an den Betrieb, sondern an den Gebrauch des Fahrzeugs an.
Zum Gebrauch des Silo-Fahrzeugs gehört dabei auch dessen Entladung, und zwar selbst dann, wenn diese nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Standort des Fahrzeugs erfolgt. Entscheidend ist, dass die Ladung – hier der Splitt – durch die am Fahrzeug vorhandenen Vorrichtungen und unter Nutzung der Motorkraft des LKW über eine Schlauchleitung auf das obere Parkdeck befördert wurde.
Der Kläger bediente sich des Fahrzeugs gerade deshalb, weil dieses die technische Möglichkeit bot, das Material zunächst zur Baustelle zu transportieren und anschließend, unter Überwindung einer gewissen Höhe, mittels eigener Betriebsvorrichtungen an die Verwendungsstelle zu fördern. Das Fahrzeug wurde somit bestimmungsgemäß sowohl als Transportmittel im öffentlichen Verkehrsraum als auch als Arbeitsmaschine auf der Baustelle eingesetzt.
Da die erforderlichen technischen Einrichtungen, insbesondere die Pumpe und die Schlauchleitung, Bestandteile des Fahrzeugs waren und durch die Motorkraft des LKW betrieben wurden, war der Schaden nach Ansicht des Gerichts „beim Gebrauch“ des Fahrzeugs entstanden.
Damit greift der Ausschluss gemäß Ziffer 5.4.1 BBH, sodass keine Deckung aus der Betriebshaftpflichtversicherung besteht.
IV. Die Auslegung: Was der „durchschnittliche Versicherungsnehmer“ versteht
Wie so oft im Versicherungsrecht beginnt alles mit dem fiktiven Wesen des „durchschnittlichen Versicherungsnehmers“ ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse (BGH, Urteil vom 6.7.2016-IV ZR 44/15 Rn.17).
Dieser, so das OLG Hamm, brauche keine Kenntnisse anderer Bedingungswerke zu haben, etwa der AKB, dürfe aber eine klare und nachvollziehbare Risikozuordnung erwarten. Ausschlussklauseln seien daher eng auszulegen, dürften aber nicht sinnentleert werden. (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2006 – IV ZR 120/05 –, BGHZ 170, 182-187, Rn. 9)
Unter diesen Prämissen prüft der Senat zweistufig:
- Liegt ein Gebrauch im Sinne der Ausschlussklausel vor?
- Handelt es sich um ein Risiko, das typischerweise von einer Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt wäre?
Beides bejaht das Gericht.
Bereits der BGH hatte in der Entscheidung vom 8.12.2015 (VI ZR 139/15 (Rn. 6), BGHZ 208, 140 ff.) festgestellt, dass ein Kraftfahrzeug auch dann „gebraucht“ wird, wenn es nur als Arbeitsmaschine eingesetzt wird. Das Ablassen von Öl aus einem Tanklastwagen mit Hilfe einer an ihm installierten Entladevorrichtung zählt zum „Gebrauch“ des Kraftfahrzeuges.
V. Der „Gebrauch“ im Detail: Wenn das Fahrzeug mehr kann als fahren
Der Senat legt dar, dass sich der Begriff des Gebrauchs nicht auf das reine Fahren beschränkt.
„Gebraucht wird ein Kraftfahrzeug auch dann, wenn es nur als Arbeitsmaschine eingesetzt wird.“
(vgl. BGH, Urteil vom 8.12.2015 , VI ZR 139/15, Rn. 22)
Damit umfasst der Gebrauch sämtliche Tätigkeiten, bei denen sich eine dem Fahrzeug typische Gefahr verwirklicht. Entscheidend ist, dass das Fahrzeug selbst oder seine fest verbundenen Vorrichtungen aktiv am Schadensgeschehen beteiligt sind.
Entscheidend ist, dass die Ladung, hier der Splitt, durch die am Fahrzeug vorhandenen Vorrichtungen und unter Nutzung der Motorkraft des LKW über eine Schlauchleitung auf das obere Parkdeck befördert wurde; im konkreten Fall war genau dies gegeben, denn der Silo-LKW transportierte den Splitt mittels seiner Pumpe und der durch die Motorkraft betriebenen Druckluftanlage über die Schlauchleitung auf das obere Parkdeck.
Der Schaden sei unmittelbare Folge der Entladetätigkeit und damit Ausdruck der Fahrzeuggefahr.
Mit einem kleinen Seitenhieb auf die Berufungsführerin fügt das Gericht an:
Auf den „Betrieb“ im Sinne des § 7 Abs. 1 StVG komme es hier nicht an, maßgeblich sei der „Gebrauch“ im Sinne der AVB.
Dass der Senat dabei zwischen den Begriffen des Straßenverkehrsrechts und der Versicherungsbedingungen fein differenziert, verdient Anerkennung, und erspart uns zugleich die übliche dogmatische Schleife über § 7 StVG.
VI. Kein Raum für die Betriebshaftpflichtversicherung
Die Berufung hatte argumentiert, die Staubentwicklung sei durch einen unterlassenen Anschluss einer externen Wasserquelle entstanden, mithin kein Risiko, das dem Fahrzeuggebrauch immanent sei
Das OLG Hamm sah das anders:
Die Staubentwicklung habe sich gerade aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs und seiner Vorrichtungen ergeben. Dass ein fehlender Wasseranschluss den Schaden verschlimmert habe, ändere nichts an der unmittelbaren Kausalität zwischen Fahrzeuggebrauch und Schaden.
Der Fall falle daher eindeutig unter den Ausschluss des § 5.4.1 BBH. Das Silo-Fahrzeug sei auch nicht eines der in § 4.9 genannten (nicht versicherungspflichtigen) Fahrzeuge, die Ausnahme greife also nicht.
Damit war klar: Die Betriebshaftpflichtversicherung ist nicht eintrittspflichtig.
Und die Kfz-Haftpflichtversicherung? Nun, sie dürfte sich über die Entscheidung nicht allzu gefreut haben, denn mit der erfolglosen Berufung war sie am Ende wieder am Zug.
Dieses Urteil ist nicht unumstritten (kritische Anmerkung Prof. Dr. Peter Schimikowski in r+s 2024, 116, 117). Dieser hält die Entscheidung des OLG Hamm für durchaus diskussionswürdig. Nach dessen Ansicht ist der Schaden nicht durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht, wenn er in erster Linie aufgrund einer fahrzeugfremden Ursache auftritt, nämlich dem Unterlassen des Anschlusses der Wasserzufuhr, was unabhängig von der Funktionsfähigkeit oder ordnungsgemäßen Bedienung des Fahrzeugs geschieht. Somit handelt es sich letztlich um eine Wertungsfrage, ob das „Schwergewicht“ der Schadensverursachung als vom Kfz ausgehend oder im menschlichen Fehlerverhalten (Unterlassen der Wasserzufuhr) angesehen wird.
VII. Die dogmatische Würze: Gebrauch ≠ Betrieb
Das Urteil illustriert einmal mehr die feine, aber folgenreiche Trennlinie zwischen den Begriffen „Betrieb“ (nach § 7 StVG) und „Gebrauch“ (nach AVB).
Während der Betriebsbegriff im Straßenverkehrsrecht an die Teilnahme am öffentlichen Verkehr anknüpft, geht der Gebrauchsbegriff im Versicherungsrecht darüber hinaus:
Er erfasst auch solche Tätigkeiten, bei denen das Fahrzeug stationär als Arbeitsmaschine verwendet wird.
Oder, weniger trocken formuliert:
Wer mit dem LKW nicht nur fährt, sondern arbeitet, gebraucht ihn und nicht selten auch seine Versicherung.
VIII. Bewertung: Zwischen Klarheit und Praxisrisiko
Die Entscheidung des OLG Hamm überzeugt in ihrer dogmatischen Stringenz. Sie folgt konsequent der BGH-Linie, dass sich die Haftungs- und Deckungszuordnung nach der Art des Risikos richtet, das sich realisiert hat.
Allerdings zeigt der Fall auch, dass diese klare Linie in der Praxis Versicherungsnehmer vor Probleme stellt. Denn häufig wissen Bauunternehmer oder Handwerksbetriebe nicht, ob der konkrete Vorgang nun als „Gebrauch“ eines Kraftfahrzeugs oder als „betriebsspezifische Tätigkeit“ einzustufen ist.
Die Folge: Deckungslücken zwischen Kfz- und Betriebshaftpflichtversicherung, die keiner der beteiligten Versicherer so recht füllen möchte.
Ein klein wenig Trost bietet immerhin die Rechtsprechung, die den Gebrauchsbegriff nicht grenzenlos ausdehnt. So hatte der BGH in älteren Entscheidungen (etwa BGH Urteil vom 27.10.1993 IV ZR 243/92, defekte Spritzanlage an Traktor) den Gebrauch verneint, wenn sich keine fahrzeugspezifische Gefahr, sondern eine bloße Gefahr des Gewerbebetriebs realisiert. In der BGH Entscheidung vom 27.10.1993 war die Hauptursache des Schadens der Defekt des Reinigungsmechanismus der Spritze und nicht das Fahren oder der Antrieb durch die Zugmaschine.
Der hier entschiedene Fall liegt dagegen klar im Bereich des Fahrzeuggebrauchs, das OLG Hamm musste also keine juristischen Klimmzüge vollführen.
IX. Praxishinweis: Vorsicht bei Entladevorgängen
Für die Praxis ist die Botschaft klar:
- Bauunternehmen sollten prüfen, welche Entladevorgänge und Arbeitsmaschinen tatsächlich durch ihre Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt sind.
- Versicherungsvermittler tun gut daran, auf mögliche Lücken hinzuweisen, gerade bei Kombinationen von Transport- und Einbautätigkeiten.
- Versicherer sollten ihre Bedingungswerke regelmäßig auf klare Abgrenzungen prüfen, um Haftungsschlupflöcher (und Blogbeiträge wie diesen) zu vermeiden.
X. Fazit: Staub aufgewirbelt, Recht geklärt
Das OLG Hamm hat den juristischen Staub präzise gebändigt:
Der Schaden entstand beim Gebrauch eines Kraftfahrzeugs im Sinne der Ausschlussklausel der Betriebshaftpflichtversicherung. Die Kfz-Haftpflichtversicherung bleibt damit in der Verantwortung.
Die Entscheidung fügt sich nahtlos in die bestehende Rechtsprechung ein, gibt aber Anlass, über die praktische Gestaltung von Versicherungsschutz im Baugewerbe nachzudenken.
Denn wenn schon Staub aufgewirbelt wird, dann bitte nur auf der Baustelle, nicht in der Deckungsprüfung.
Quellen:
- BGH, Urteil vom 8.12.2015 – VI ZR 139/15, BGHZ 208, 140 ff.
- BGH, Urteil vom 27.10.1993 – IV ZR 243/92, VersR 1994, 83
- BGH Urteil vom 6.7.2016 – IV ZR 44/15 Rn.17
- OLG Hamm r+s 2024, 116, 117
Autorinnen:
Greta Hansen & Eva Nagel