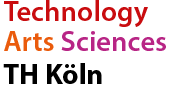Von Severin Krauth und Christopher Kunzlmann
Der Beitrag wurde im Rahmen des Masterstudiengangs Versicherungsrecht an der TH Köln Modul 6 – Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung – erstellt
1. Der Sachverhalt
Ein Landwirt verpflichtete sich vertraglich gegenüber der Betreiberin einer Windenergieanlage, die Fläche in deren Umkreis in bestimmter, naturschutzkonformer Weise zu bewirtschaften, damit die Greifvögel friedlich kreisen und das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zufrieden schlafen konnte. Doch im Frühjahr 2021 kam der Fauxpas: Statt der vereinbarten „vogelfreundlichen“ Frucht landete Mais auf der Fläche.
Die Behörde fand das weniger köstlich. Sie stoppte den Betrieb der Windkraftanlage für knapp zwei Monate. Die Betreiberin (Fa. G) rechnete fix nach und forderte rund 58.000 Euro Schadensersatz vom Landwirt. Der wiederum wandte sich an seinen Haftpflichtversicherer – schließlich ist das ja irgendwie ein Schaden.
Doch der Versicherer winkte ab. Und so landete der Streit vor Gericht.
2. Der Streit
Der Landwirt sieht in der Schadensersatzforderung der Fa. G einen von seiner Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung gedeckten Schaden. Der Versicherer sieht dies grundsätzlich gleich. Das Schadensereignis ist gemäß Nr. 1.1, 2.1. AHB iVm. Nr. B 1.18.2 S.1 BB zwar vom Deckungsumfang in Form eines reinen Vermögensschadens (Entstehung weder durch Personen- noch Sachschaden) umfasst. Im vorliegenden Schadensszenario ist allerdings der Versicherungsschutz gemäß Nr. 1.2 (3) ausgeschlossen.
Begründung: Der Schaden der Windkraftbetreiberin betreffe ihr „Erfüllungsinteresse“, also den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Vertrag – hier: den ungestörten Betrieb der Windräder.
Solche Schäden seien ausgeschlossen, denn sie ersetzen nur das, was der Vertragspartner ursprünglich versprochen bekommen sollte.
Oder juristisch trocken formuliert: „Kein Schutz für Schadensersatz wegen des Ausfalls des geschuldeten Erfolgs gemäß Nr. 1.2 (3) AHB.“ Mit anderen Worten: Wer vertraglich zusagt, etwas Bestimmtes zu leisten (z. B. bestimmte Bewirtschaftung), kann den Ausfall dieser Leistung oder das Ausbleiben des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges nicht über die Haftpflichtversicherung absichern.
3. Der Kern der Entscheidung
Das Gericht unterscheidet scharf zwischen
- Erfüllungsinteresse – wenn jemand will, dass der Vertrag so erfüllt wird, wie versprochen (nicht versichert),
- Integritätsinteresse – wenn etwas außerhalb des Vertrags beschädigt wird (z. B. fremdes Eigentum; versichert).
Es muss demnach zwischen dem ausgeschlossenen Äquivalenzinteresse und dem nicht ausgeschlossenen Integritäts- und Erhaltungsinteresse unterschieden werden. Beim Äquivalenzinteresse sind die Ansprüche des Vertragspartners auf sein Erfüllungsinteresse, also das unmittelbare Interesse am Leistungsgegenstand gerichtet (vgl. BGH, Beschluss vom 28. September 2011 – IV ZR 170/10).
Da die Windradbetreiberin bloß ihren wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrag verlor, lag kein versicherter Schaden vor. Und auch das Argument des Landwirts, dass die Nutzungsuntersagung durch die Behörde ein „außervertragliches Ereignis“ sei, zog nicht. Laut dem OLG war die behördliche Anordnung gerade das Risiko, das durch die Vertragsgestaltung vermieden werden sollte.
4. Kein Platz für Mitleid im Versicherungsrecht
Der Landwirt argumentierte, dass er wegen eines kleinen Versehens nun existenzgefährdend haften müsse – während die Windparkbetreiberin als Kapitalgesellschaft locker bleibe. Das Gericht sah darin aber keinen Grund, den Vertrag „gerechtigkeitsfreundlich“ auszulegen.
Verträge gelten, auch wenn sie manchmal ungnädig sind. Oder wie man im Saarland sagen würde: „Versichert is’ versichert – un’ wat net drin is, is halt net drin.“
5. Fazit: Versicherungsdeckung endet, wo die Pflicht beginnt
Das OLG Saarbrücken bestätigt die ständige Linie der Rechtsprechung zum Ausschluss von Erfüllungsschäden (vgl. OLG Köln, Urteil vom 29. Juli 2003 – 9 U 165/02, VersR 2004, 223). Die
Haftpflichtversicherung schützt auch nicht gegen die eigenen Vertragsrisiken, zu denen auch Nutzungsausfall wegen Mangelhaftigkeit der Arbeit und daraus entgangenem Gewinn gehören (BGH VersR 2012, 96; BGH VersR 1985, 1153; OLG Naumburg VersR 1997, 179; OLG Düsseldorf r+s 2006, 327).
Wer also eine Fläche, ein Werk oder eine Leistung schuldet, kann nicht erwarten, dass seine Versicherung einspringt, wenn er den Vertrag schlecht oder falsch erfüllt (vgl. Lücke in Prölss/Martin, VVG, 32. Auflage 2024, AHB Abs. 1 Rn. 48). Das gilt auch, wenn die finanziellen Folgen unvorhergesehen hoch sind – oder der Mais zu viel Sonne gesehen hat.
6. Praxistipp
Der Fall zeigt, dass Landwirte, die Windkraftanlagenbetreibern Flächen zur Verfügung stellen, ein beträchtliches Haftungsrisiko tragen, wenn sie ihrem Vertragspartner die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Auflagen vertraglich zusagen. Im vorliegenden Fall erhielt der Landwirt vom Anlagenbetreiber etwa 1.000 Euro jährlich, wurde (aber) iHv 58.000 Euro wegen Nutzungsentgang in Anspruch genommen, weil die Behörde wegen des Fehlers des Landwirts die Anlage stilllegte. Versicherer und Makler sind gefordert, Sonderlösungen im Rahmen von Vermögensschadendeckungen zu entwickeln, welche die hier aufgezeigte Deckungslücke – mit Sublimit und Selbstbehalt – schließen. Ansonsten droht womöglich auch anderen Landwirten im Ernstfall ein ähnliches Ergebnis wie hier: Windräder stehen still und die Versicherung bewegt sich auch nicht.