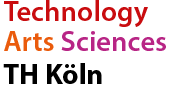Zur Anwendbarkeit der Kriegsklausel in der Betriebshaftpflichtversicherung bei Fliegerbombenfunden
Von Laura Pieper und Lara Stolle
Der Beitrag wurde im Rahmen des Studiengangs Versicherungsrecht an der TH Köln im Modul 6 – Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherungsrecht – erstellt
Stellen Sie sich vor: Ein Bagger gräbt auf einer Baustelle und stößt auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein nicht seltenes Szenario, was vor allem Kölner*innen bekannt sein sollte:
Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zuletzt am 04.06.2025 gefunden und sorgte für eine große Herausforderung. Die größte Evakuierung seit 1945 hat die komplette Innenstadt inkl. des Kölner Hauptbahnhofs lahmgelegt.
In dem Fall des LG Frankfurts (Oder, Urteil vom 3.7.2024 – 15 O203/23) ist genau das passiert: Aufgrund des Funds einer Fliegerbombe wurde eine Evakuierung in einem Ort in Bandenburg vorgenommen. Jedoch konnte die Bombe nicht entschärft werden und musste zum Leid der Anwohner kontrolliert gesprengt werden. Doch haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was passiert, wenn es bei einer kontrollierten Sprengung zu erheblichen Schäden zum Beispiel an Nachbargebäuden kommt? Und vor allem: Wer zahlt und besteht Deckung im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung des Bauunternehmers, der die Bombe bei seinen Arbeiten gefunden hat?
Diese Fragen standen im Zentrum des Urteils des Landgerichts Frankfurt (Oder) vom 3. Juli 2024 (Az. 15 O 203/23). Die Entscheidung hat nicht nur juristische Relevanz, sondern auch eine gewisse Dramatik. Schließlich geht es um explosive Altlasten, Versicherungsbedingungen und die Frage, ob der Zweite Weltkrieg auch heute noch als „Krieg“ im Sinne der Versicherungsbedingungen gilt.
Der Fall: Wenn Geschichte auf Gegenwart trifft
Ein Bauunternehmen stieß bei Erdarbeiten in Brandenburg im März 2021 auf eine Weltkriegsbombe. Die herbeigerufenen Experten entschieden sich für eine kontrollierte Sprengung mit erheblichen Folgen: Mehrere umliegende Gebäude wurden beschädigt. Die betroffenen Eigentümer forderten Schadensersatz. Das Bauunternehmen wandte sich an seine Betriebshaftpflichtversicherung, doch die verneinte die Regulierung. Begründet hat der Versicherer dies mit der sogenannten Kriegsklausel. Diese schließt Schäden durch Kriegsereignisse aus und eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg beruht durchaus auf einem Kriegsereignis. Der völkerrechtliche Begriff Krieg ist für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer zum einen ein bewaffneter Kampf zwischen Staaten und zum anderen muss eine Kriegserklärung ausgesprochen werden. Wie ist nun die Kriegsklausel zu verstehen?
Die juristische Zündschnur: Was sagt die Kriegsklausel?
Warum genau greift die Kriegsklausel hier nicht? Und was bedeutet das für die Betriebshaftpflichtversicherung?
Die meisten Betriebshaftpflichtversicherungen enthalten eine sogenannte Kriegsklausel. Diese schließt Schäden aus, die „unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder Maßnahmen von hoher Hand“ verursacht wurden. Doch wie weit reicht dieser Ausschluss? Gilt eine kontrollierte Sprengung einer 80 Jahre alten Bombe wirklich als „mittelbare Kriegsfolge“?
Das LG Frankfurt (Oder) sagt: Nein.
Entscheidend ist, ob beim Schadensereignis ein adäquat (auch mittelbar) verursachender Umstand vorliegt, der ohne den Krieg so nicht eingetreten wäre. Auf den völkerrechtlichen Kriegsbegriff kommt es hierbei nicht an. In diesem Fall verhält es sich so, dass das Ereignis, das den Schaden verursacht hat, nicht durch den Krieg selbst entstanden ist, sondern vielmehr durch die Sprengung.
Das LG stellt aber klar, dass Spätschäden aus früheren Kriegen (z. B. das Auffinden und Entschärfen/Detonieren einer im 2. Weltkrieg abgeworfenen Fliegerbombe) nicht ohne Weiteres vom Kriegsausschluss im Sinne der Versicherungsbedingungen erfasst werden. Mit zunehmender Dauer des Friedenszeitraums hat die Kriegsklausel an Bedeutung verloren: bei klassischen „Blindgängern“ aus dem Zweiten Weltkrieg greift diese regelmäßig nicht.
Außerdem ist die Kriegsklausel als Ausschlussklausel einschränkend, also nach ständiger Rechtsprechung eng auszulegen. Maßgeblich ist der erkennbare Sinn und Zweck der Klausel. Der Versicherungsnehmer darf nicht durch die Auslegung benachteiligt werden und Unklarheiten in der Formulierung gehen zulasten des Versicherers. Für den Versicherungsnehmer muss transparent und verständlich in den Versicherungsbedingungen definiert sein, inwieweit wirtschaftliche Nachteile und Belastungen entstehen können.
Für den Bauunternehmer bedeutet das erst einmal, dass seine Versicherung Deckung gewähren muss.
Versicherungsrechtliche Einordnung der Sprengung einer Weltkriegsbombe
Die sogenannte Kriegsklausel ist ein Klassiker in Versicherungsbedingungen. Sie lautet sinngemäß:
„Nicht versichert sind Schäden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen oder ähnliche Ereignisse verursacht werden.“
Der Zweck ist eindeutig: Versicherer wollen sich gegen systemische Risiken absichern, die sie nicht kalkulieren können. Außerdem versuchen sie, dadurch das Kumulrisiko zu begrenzen. Dabei erleiden eine Vielzahl von Versicherungsnehmern gleichzeitig einen Schaden durch den Eintritt desselben zufälligen Ereignisses, also den Kriegsausbruch.
Generell lässt sich festhalten, dass das Versicherungsprinzip, der Risikoausgleich im Kollektiv für den Schaden des Einzelnen, in Kriegszeiten – eben durch die Häufung der Schäden – grundsätzlich nicht funktioniert. Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Krieg und dem Schaden bestehen. Die Beweislast trägt der Versicherer.
Der Knackpunkt: Was ist ein „Kriegsereignis“?
Das LG Frankfurt (Oder) hat versucht, diesen Begriff juristisch zu definieren. Die Richter:innen argumentierten:
- Die Sprengung sei ein ziviles Gefahrenabwehrereignis, nicht Teil eines militärischen Konflikts.
- Die Kausalität sei entscheidend: Nicht der Krieg selbst, sondern die heutige Entscheidung zur Sprengung habe den Schaden verursacht. Die Ausschlussklausel findet also nur Anwendung bei allen Schäden, die adäquat durch Krieg verursacht werden und unter ihren Schutzzweck fallen.
- Eine zeitliche und sachliche Distanz zum eigentlichen Kriegsgeschehen sei gegeben, immerhin liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs fast 80 Jahre zurück. Somit haben wir keine anormale Gefahrenlager mehr, sondern eine (neue) „Normalgefahr“. Ab diesem Moment ist der Versicherer in der Lage, das erhöhte Risiko in seine Prämienberechnung mit einzukalkulieren. Kann der Versicherer das Risiko in seine Prämienberechnung einkalkulieren, entfällt seine besondere Schutzbedürftigkeit und die entsprechende Gefahr unterfällt nicht mehr dem Kriegsausschluss. Der Zusammenhang mit dem Krieg lockert sich somit mit der Zeit.
Der Versicherungsfall: Deckung trotz Explosion
Die Betriebshaftpflichtversicherung greift grundsätzlich bei Schäden, die aus der betrieblichen Tätigkeit entstehen. Dazu zählt auch der Umgang mit Kampfmitteln, sofern dieser zum versicherten Risiko gehört.
Das Gericht stellte klar: Die Sprengung war Teil der Gefahrenabwehr im Rahmen der Bautätigkeit und damit vom Versicherungsschutz umfasst. Zusätzlich haben die Mitarbeitenden des Bauunternehmens vorbildlich gehandelt und sofort die nötigen Schritte zur sicheren Gefahrenabwehr eingeleitet. Damit kann auch nicht in irgendeiner Hinsicht von einer vorsätzlichen Schadenverursachung (§ 103 VVG) gesprochen werden. Der Bauunternehmer hat die Schädigung der Nachbarhäuser nicht billigend in Kauf genommen.
Versicherungsrechtliche und praktische Konsequenzen für Bauunternehmen und Versicherer
Nach der juristischen Analyse ergeben sich einige wichtige Lehren für Bauunternehmen, Versicherer und auch für die Rechtsprechung.
Für Bauunternehmen:
- Kampfmittelräumung ist kein Sonderfall mehr, sondern Teil des Alltags auf vielen Baustellen, insbesondere in ehemaligen Kriegsgebieten.
- Unternehmen sollten prüfen, ob ihre Betriebshaftpflichtversicherung explizit auch Kampfmittelrisiken abdeckt.
- Eine enge Zusammenarbeit mit Kampfmittelräumdiensten und Behörden ist unerlässlich, auch zur Haftungsvermeidung.
Für Versicherer:
- Die Entscheidung zeigt, dass unscharf formulierte Ausschlüsse wie die Kriegsklausel nicht ausreichen, um sich pauschal von der Leistungspflicht zu befreien.
Für die Rechtsprechung:
- Das Urteil dürfte Signalwirkung für ähnliche Fälle haben gerade in Regionen mit hoher Bombenfunddichte.
- Es zeigt, wie wichtig eine zeitgemäße Auslegung von Versicherungsbedingungen ist. Auch andere Gerichte werden sich künftig an dieser Entscheidung orientieren.
Fazit: Warum das Urteil wichtig ist
Dieses Urteil ist ein Paradebeispiel für die Frage, wie weit historische Ereignisse in die Gegenwart hineinwirken dürfen. Es zeigt auch, dass Versicherer mit Ausschlussklauseln nicht immer durchkommen. Insbesondere dann nicht, wenn sie versuchen, jahrzehntealte Kriegsereignisse als Begründung für eine Leistungsfreiheit heranzuziehen. Die Sprengung einer Fliegerbombe ist kein Kriegsereignis, zumindest nicht im Sinne der Betriebshaftpflichtversicherung. Die Vergangenheit darf nicht als pauschale Ausrede für die Ablehnung heutiger Schäden herhalten. Entscheidend bleiben die konkrete Ursachenkette und die genaue Klauselformulierung. Wenn Versicherer das Risiko von Explosionsschäden durch Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg vom Versicherungsschutz ausschließen wollen, müssen sie das in der Klausel präzise zum Ausdruck bringen.