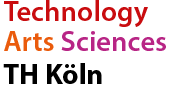Besprechung von OLG Celle, Urteil vom 18.01.2024 – 11 U 53/23
Die Urteilsanmerkung wurde im Rahmen des Masterstudiengangs Versicherungsrecht an der TH Köln im Modul Allgemeines Versicherungsvertragsrecht angefertigt (Sommersemester 2025)
Bearbeiter: Severin Krauth
Leitsätze:
1. Der Miteigentümer eines Gebäudes ist nicht automatisch der Repräsentant des Versicherungsnehmers in der Sachversicherung.
2. Erhebt der Versicherer den Vorwurf vorsätzlicher Brandstiftung, muss er den Vollbeweis führen.
- Problemstellung
Treten nach einem Brandschaden Hinweise auf eine vorsätzliche Schadenstiftung auf, so sind diese trotz in der Praxis bekanntem Vorgehen zur verzögerten Brandstiftung nicht immer eindeutig. Im vorliegenden Fall stellte sich die Frage, ob der Brand vorsätzlich verursacht wurde oder nur eine Verkettung unglücklicher Umstände zum Brand geführt hat. Es musste in diesem Fall auch geprüft werden, ob der Ehemann, dem Brandstiftung vorgeworfen wurde, versicherungsrechtlich als Repräsentant der Versicherungsnehmerin anzusehen ist.
Das OLG Celle hatte sich also mit den Fragen zu befassen, ob der Klägerin (Versicherungsnehmerin) bedingungsgemäßer Versicherungsschutz zusteht, ob die Klägerin sich das Verhalten ihres Mannes zurechnen lassen muss und wann die volle Beweisführung für den Vorwurf der vorsätzlichen Brandstiftung ausreichend gegeben ist.
- Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Am 18. Juli 2018 wurden das Haus und der Hausrat der Klägerin durch einen Brand beschädigt oder zerstört. Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage die Feststellung ihres Anspruchs auf Versicherungsschutz im Rahmen der Gebäudeversicherung.
Im Jugendzimmer und dem benachbarten Ankleidezimmer des Einfamilienhauses (1. OG) wurden vor Eintritt des Schadenfalles Renovierungsarbeiten durchgeführt. Nachdem die Eheleute am Schadentag das Haus verlassen haben, unterhielten sie sich noch ca. 15 Minuten mit den Nachbarn vor dem Haus. In dieser Zeit waren noch keine Anzeichen eines Brandes zu erkennen. Kurze Zeit später bemerkten spielende Kinder auf der Straße Rauch und das Ertönen der im Haus angebrachten Rauchmelder. Das war insoweit unstreitig.
Die Renovierungsarbeiten wurden alleinig durch den Ehemann der Klägerin vorgenommen. Der Ehemann ist hälftiger Miteigentümer des Hauses, nicht aber Versicherungsnehmer. In diesem Zusammenhang wurde vorweg die Repräsentantenstellung des Ehemanns durch das OLG Celle geprüft und verneint, da dieser nicht die alleinige Obhut und Entscheidungsbefugnis über das Objekt innehatte. Die Tatsache, dass der Ehemann die Renovierung alleine vorgenommen hat, reiche hierfür – so das Gericht – nicht aus. Sonst würde auch jeder beliebige Handwerker mit vergleichbaren Aufgaben zum Repräsentanten des Versicherungsnehmers werden. Zudem gibt es auch keine Feststellungen, dass der Ehemann Art und Umfang der Renovierungsarbeiten ausführen durfte, ohne sich mit der Klägerin abzustimmen. Daraus folgert das OLG, dass die Klägerin sich das Verhalten ihres Ehemannes nicht zurechnen lassen muss. Sie hat somit auf denjenigen Teil der Versicherungsleistung, der auf ihre Eigentumshälfte entfällt, in jedem Fall Anspruch.
Im Hinblick auf die dem Ehemann gehörende Hälfte am Haus und am Hausrat muss folglich geprüft werden, ob die Versicherung leistungsfrei aufgrund vorsätzlicher Handlung ist (§§ 81 I, 47 I VVG). Das Gericht würdigt die Schadengutachten eines Privatsachverständigen und eines Gerichtssachverständigen. Wie aus diesen Gutachten hervorgeht, liegen dem Schaden zwei Brandschwerpunkte zu Grunde. Der erste Schwerpunkt entstand durch eine auf dem Fußboden des Jugendzimmers liegende Glühlampe. Es handelte sich der Spurenlage nach hierbei um eine konventionelle Glühlampe, die nur in eine Fassung ohne jegliche Art von Schirm gedreht war. Ein Schalter zwischen Stecker und Glühbirne war nicht vorhanden, so dass diese nach dem Einstecken dauerhaft leuchtete und Wärme erzeugte. Bei diesem Equipment handelt es sich – wie das Gericht auch feststellt – um ein häufiger vorkommendes Mittel zur zeitverzögerten Brandstiftung. Eine Feststellung der Wattleistung und somit der möglichen Wärmeerzeugung konnte nicht mehr erzielt werden. Auffällig und verdächtig erschien dem Gericht, dass am Brandherd verschütteter Universalverdünner festgestellt wurde. Es dürfe hierbei aber nicht außer Acht gelassen werden, dass der Verdünner bereits drei Tage vor Brandentstehung verschüttet wurde. Eine zeitlich nähere Freisetzung konnte die beklagte Versicherung nicht nachweisen. Die Tatsachen, dass besagter Universalverdünner bereits nach zwei Tagen vollständig verdampft ist (so Privatsachverständiger G) und der Ehemann der Klägerin zwei gelbe Säcke mit leeren Kanistern und zusammengeknülltem Malervlies mit massivem Verdünnergeruch vorzeigen konnte, weist auf einen fehlenden Zusammenhang hin. Der Senat geht davon aus, das brandgefährlichste Material sei bereits vor dem Brand entfernt worden. Schwieriger gestalte sich nach Auffassung des OLG die Beurteilung der Angaben zum Ablageort der Lampe. Der Ehemann der Klägerin hatte angegeben, er habe am 17. Juli 2018 die Lampe nach deren Gebrauch eine halbe Umdrehung aus der Fassung gedreht und in diesem Zustand auf eine Mehrzweckplatte gelegt, die künftig als Tisch fungieren sollte. Gegenüber dem Privatsachverständigen G gab der Ehemann aber an, die Feuerwehr habe die Lampe auf dem Fußboden liegend gefunden und dann auf den Tisch gelegt. Das erscheint widersprüchlich. Der Senat weist jedoch darauf hin, die Glühlampe könne heruntergerollt oder von den Kindern herabgerissen worden sein. Es seien verschiedene Erklärungen denkbar. Der Senat sieht in diesem Zusammenhang die Grenzen dessen, was ein Gericht im Rahmen der Überzeugungsbildung nach § 286 I ZPO in Betracht ziehen darf, auch nicht als überschritten.
Der zweite Schwerpunkt der Brandentstehung lag im Kleiderschrank des benachbarten Ankleidezimmers. Die Klärung, ob die beiden Schwerpunkte wirklich isoliert entstanden sind oder Folge einer Brandbrücke waren, ist essentiell, da das Landgericht im vorausgegangenen Urteil hiermit maßgeblich die vorsätzliche Brandstiftung begründete. Das OLG stellt fest, weder der Gerichtssachverständige noch der Privatsachverständige G legten eine Vermutung geschweige denn einen konkreten Anhaltspunkt vor, wie der zweite Brandherd im Ankleidezimmer entstanden sein könnte. Lediglich die Entstehung durch einen technischen Defekt konnte ausgeschlossen werden. Die Annahme, dass der Brand durch das manuelle Entzünden von Kleidung im Schrank entstand, liege – so der Senat – zunächst nahe, da die Entstehung des ersten Brandherdes ein häufigeres Mittel zur Brandstiftung darstellt. Diese Hypothese hält nach Ansicht des Senats allerdings einer näheren Überprüfung nicht stand, da das schlichte Entzünden von Kleidung im Zusammenhang mit dem eher fachmännischen Platzieren einer Glühlampe nicht in Einklang zu bringen sei. Das Gericht weist auch darauf hin, dass das Entzünden von Kleidern eher zu einer schnellen Brandausbreitung geführt hätte. Abgesehen davon lasse der Gerichtssachverständige in seiner mündlichen Aussage offen, ob der zweite Brandschwerpunkt durch einen Durchzug von Rauchgasen hätte entstehen können. Es erscheine grundsätzlich möglich, dass durch die Rauchgase, die sich an der Decke gesammelt hatten, eine Entzündung im Kleiderschrank entstanden ist. Dafür hätten die Utensilien im Kleiderschrank eine hohe Heizenergie haben müssen. Ob dies der Fall war, hat der Senat aus eigener Kenntnis heraus nicht zu beurteilen vermocht. Zudem habe – so der Senat – auch die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht eine Durchzündung ausdrücklich erwähnt. Der zweite Sachverständige E wiederum habe offensichtlich für sich die Überzeugung gewonnen, dass der Brand bewusst verursacht wurde. Das Gericht zeigte sich hievon nicht überzeugt. Es fehle folglich an der Gewissheit, wie der erste und vor allem wie der zweite Brandherd entstanden ist. Die polizeilichen Maßnahmen zur Aufklärung waren – so der Senat – völlig unzureichend. Nach Aktenlage fehlte es an jeglicher gründlicher und zeitnaher Nachsuche – dies dürfe nicht der Klägerin angelastet werden. Der beklagten Versicherung hätte es freigestanden, eine professionelle Brandermittlung zeitnah zu veranlassen. Alle Sachverständigen, sowohl E als auch G sowie der aufgrund der Zweifel durch die Klägerin hinzugezogene Sachverständige Dr. B sind sich zwar darin einig, dass der erste Brandherd durch die Glühlampe entstanden ist. Es bleibe allerdings ungeklärt, wie die Glühlampe an die Stelle gelangte. Der Senat stellt fest, dass die Eheleute vor dem Brand in gesicherten finanziellen Verhältnissen lebten und das Haus gerade einmal vier Jahre alt war. Ein rationales Motiv oder ein finanzieller Vorteil für eine Brandstiftung sei somit auch nicht zu erkennen. Ferner führt das Gericht an, dass die Eheleute Ersatzwohnraum für sich und ihre fünf Kinder suchen mussten, was eine erhebliche Belastung und Einbuße an Wohnqualität mit sich bringt. Selbst das Zurücklassen des Hamsters (der in Folge des Brandes verendete) berücksichtigt der Senat: Er überlegt, dass ein nicht besonders „abgebrühter“ vorsätzlich handelnder Täter das Tier wohl unauffällig vorab in den Garten gebracht hätte. Dies wäre im Sommermonat Juli niemandem aufgefallen. Somit ist der Senat im Ergebnis nicht mit dem gemäß § 286 I ZPO erforderlichem Maße von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch den Ehemann der Klägerin überzeugt.
Auch die hilfsweise Berufung auf teilweise Leistungsfreiheit wegen grob fahrlässiger Herbeiführung nach § 47 I, § 81 II VVG durch den Ehemann lässt – so das Gericht – sich nicht belastbar feststellen. Wie bereits zur Frage des Vorsatzes lasse sich mit der nötigen Gewissheit nur feststellen, dass eine nicht abgeschirmte Glühlampe in der Nähe des Brandherdes aufgefunden wurde. Nicht lasse sich jedoch feststellen, ob der Ehemann diese nur vergessen oder bewusst abgelegt hatte. Wenn Letzteres gegeben wäre, würde nach Ansicht des Senats wohl ein grob fahrlässiges Verhalten naheliegen. Im vorliegenden Fall fehle hierfür jedoch der Beweis.
- Kontext der Entscheidung
I. Die Frage über maßgebende Regelungen zur Zurechnung des Verhaltens Dritter an den Versicherungsnehmer stellt sich im Versicherungsrecht immer wieder (Karczewski in: Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG 5. Auflage 2025, § 81 Rn. 67). Ausschlaggebend für die Annahme der Repräsentantenstellung ist, dass die Risikoverwaltung anstelle des Versicherungsnehmers übernommen worden sein muss. Die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht ohne Risikoübernahme reicht hier nicht aus (BGH Urt. v. 21.04.1993 – IV ZR 34/92). Ehegatten, die lediglich neben dem Versicherungsnehmer/der Versicherungsnehmerin die versicherten Sachen einer Hausrat- oder Gebäudeversicherung in (Mit-)Obhut haben, scheiden als Repräsentanten aus. Der Versicherungsnehmer hat sich hier nämlich regelmäßig nicht von der Risikoverwaltung zurückgezogen (Steinbeck in: MünchAnwaltshandb. Versicherungsrecht, Höra/Schubach, 5. Auflage 2022, § 2 Rn. 364 m.w.N.). Demgegenüber könnte die höchstrichterliche Rechtsprechung stehen, nämlich, dass beim Abschluss einer gemeinsamen Versicherung für das gemeinsame Eigentum von einer Gesamtschuld auszugehen ist und sich beide Mitversicherte das Verhalten des jeweils anderen anrechnen lassen müssen (BGH, Urt. v. 16.11.2005 – IV ZR 307/04). Allerdings hat die Klägerin im vorliegenden Fall alleinig den Versicherungsschutz beantragt und geführt. Etwas Gegenteiliges lässt sich zumindest nicht erkennen. Folglich bestätigt die Entscheidung des OLG Celle einmal mehr, dass Ehegatten bzw. Miteigentümer nicht automatisch als Repräsentanten anzusehen sind. Infolgedessen ist die Brandursache in diesem Fall für den Teil des Eigentums, welcher der Klägerin zugerechnet werden kann, irrelevant. Der Versicherungsnehmerin steht somit zu Recht für ihren Teil des Eigentums uneingeschränkt Versicherungsschutz zu.
II.Anders sieht es das OLG Celle im Ergebnis zutreffend für den versicherten Eigentumsanteil des Ehemannes der Klägerin. Für diesen Teil ist es unerheblich, ob der Ehemann auch Repräsentant der Versicherungsnehmerin ist, es liegt nämlich eine teilweise Fremdversicherung i.S.d. §§ 43 ff. VVG vor (vgl. Prölss/Martin/Armbrüster, VVG 31. Aufl. § 28 Rn. 115). Der streitigen Tatsachenfrage nach einer vorsätzlichen Brandstiftung kommt Entscheidungserheblichkeit insoweit nur noch auf die dem Ehemann gehörende Hälfte des Eigentums zu.
III. Vorsätzlich handelt, wer willentlich und wissentlich den Versicherungsfall herbeiführt (direkter Vorsatz). Im Hinblick auf § 81 VVG reicht jedoch auch ein bedingter Vorsatz aus. Somit genügt es, wenn der Handelnde den Erfolg seiner Tat billigend in Kauf nimmt (Armbrüster in: Prölss/Martin, VVG 32. Aufl. 2024, § 81 Rn. 29).
Den Beweis hierfür hat nach hM der Versicherer zu erbringen. Es ist die Führung eines Vollbeweises vonnöten, ohne jegliche Beweiserleichterung. Daraus folgt, dass dem entscheidenden Senat durch den Vortrag des Versicherers ein derart verdichteter Tathergang schlüssig werden muss, dass dieser von einer Eigenbrandstiftung überzeugt ist – auch wenn dieser nicht mit ´´mathematischer Genauigkeit´´ nachgewiesen wird. (Piontek/Tschersich in: Langheid/Wandt, MünchKomm VVG, 3. Aufl. 2024, Kap. 17 Rn. 351).
Dies kann der Versicherer durch einen unmittelbaren Beweis (z.B. Brandbeschleuniger) erreichen, einen Anscheinsbeweis oder durch ein hieb- und stichfestes Eliminationsverfahren, bei dem als einzig verbleibende Möglichkeit die Brandstiftung bleibt (Hoenicke in: Weith/Gräfe/Lange/Rogler, Der Versicherungsprozess, 5. Aufl. 2023, § 4 Rn. 343).
Im vorliegenden Fall kam ein Anscheinsbeweis nicht in Betracht, da kein typischer Geschehensablauf vorlag. In der Praxis, so auch bei diesem Brandschaden, dominiert meist der Sachverständigenbeweis in Form des Eliminationsverfahren. Der Vorteil liegt hier auf der Hand. Ein Negativbeweis ist meist deutlich einfacher zu führen als ein positiver Nachweis. In diesem Fall wurden alle Ursachen, wie technische Defekte und naturwissenschaftliche Vorgänge, mit der erforderlichen Sicherheit durch die beteiligten Sachverständigen ausgeschlossen. Das Liegenlassen der Glühlampe am ersten Brandherd, als in der Praxis häufiger vorkommendes Mittel zur verzögerter Brandstiftung, wirkt verdächtig. Jedoch konnte ein versehentliches Herabfallen der Glühlampe vom Tisch auf den Boden genauso wenig ausgeschlossen werden wie der womöglich erst durch den Fall der Lampe entstandene Stromfluss zur Entstehung des Wärmeherdes. Das Auffinden des Universalverdünners am ersten Brandschwerpunkt ist grundsätzlich der positive Nachweis für eine vorsätzliche Brandstiftung und kann einem Brandbeschleuniger gleichgestellt werden. Jedoch konnte hier, durch die zeitliche Spanne des Verschüttens und des Brandes (drei Tage) sowie durch die Entfernung der wirklich leicht entzündlichen Überreste (Malervlies und Kanister), keine eindeutige Spur festgestellt werden. Ähnlich auch der Brand am zweiten Schwerpunkt. Mehr als Vermutungen über einen Durchzug, das manuelle Entzünden von Kleidung oder mögliche in Brandbeschleuniger getränkte Kleidung die durch eine Hitzeübertragung entzündet worden sein könnte, konnte über die Entstehung nicht mit Gewissheit nachgewiesen werden. Im Gegenteil, es sprachen sogar einige Punkte gegen diese Theorien, wie das streitige Fachwissen des Ehemannes und die Lage des Kleiderschrankes. Auch sprechen einige weitere Beweisanzeichen gegen eine Eigenbrandstiftung. Der Ehemann der Klägerin gab zwar teilweise widersprüchliche Angaben an (Ablageort der Glühlampe), diese sind aber keineswegs objektiv feststehende Sachverhalte und somit nicht maßgebend. Des Weiteren hat der Ehemann weder Wertsachen noch Tiere weggeschafft, die Rauchmelder blieben intakt und die Türe ins Treppenhaus blieb offen. Weiter hatten die Klägerin und ihr Ehemann kein wirkliches Tatmotiv, was von besonders indizieller Bedeutung sein kann. Sie lebten vor dem Brand in gesicherten finanziellen Verhältnissen und hatten ein erst vier Jahre altes Haus. Unter Würdigung der Gesamtschau aller Indizien, nach einer einzelnen Betrachtung jedes Anzeichens für sich, konnte der Senat somit keinen ausreichenden in sich schlüssigen Tathergang feststellen. Somit musste offenbleiben, ob es sich um eine vorsätzliche oder lediglich fahrlässige Brandstiftung handelt (vgl. Rintelen in: Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrecht-Handbuch, 4. Aufl. 2025, § 28 Rn. 295-299; Günther in: Der zivilrechtliche Nachweis der Eigenbrandstiftung, r+s 2006, 221; Spielmann in: Langheid/Wandt, MünchKomm VVG, 3. Aufl. 2025, Kap. 49 Rn. 159a).
IV. Abschließend stand noch zur Klärung, ob es sich wie hilfsweise von der Beklagten gefordert, um eine grobe Fahrlässigkeit des Ehemannes gehandelt hat und der Versicherer nach § 81 II VVG zur entsprechenden Kürzung der Versicherungsleistung berechtigt ist. Grobfahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen unbeachtet lässt und in außergewöhnlich hohem Maße verletzt. Die Beweispflicht hierfür trägt ebenfalls der Versicherer (Karczewski in: Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG, 5. Aufl. 2025, § 81 Rn. 8). Wie bereits erörtert, konnte im vorliegenden Fall mit der notwendigen Gewissheit lediglich festgestellt werden, dass eine Glühlampe ohne Schalter in der Nähe des Entstehungsortes des ersten Brandherdes aufgefunden wurde. Allerdings ist nicht aufzuklären, ob der Ehemann diese wirklich im Betrieb befindlich dort liegengelassen hat oder ob weiteres leicht entzündliches Material dort vorlag. Ließe sich etwas Derartiges feststellen, könnte wohl von einer groben Fahrlässigkeit gesprochen werden. Diese Umstände stehen allerdings nicht fest und ein grob fahrlässiges Verhalten des Ehemannes hat sich nicht nachweislich verwirklicht.
- Auswirkung auf die Praxis
Einmal mehr bestätigt das OLG mit diesem Urteil die Wichtigkeit der Abgrenzung, wann genau es sich bei einem Miteigentümer um einen Repräsentanten des Versicherungsnehmers handelt und wann nicht. Auch wenn sich auf den ersten Blick für einen juristischen Laien vermuten lassen könnte, dass der Ehemann und Miteigentümer des Hauses der Klägerin als Repräsentant anzusehen sei, ist das nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung und hM in der Literatur nur dann der Fall, wenn die Voraussetzungen einer Risiko- oder Vertragsverwaltung gegeben sind. Beides war vorliegend nicht gegeben. Somit muss sich die Versicherungsnehmerin die möglicherweise vorliegende vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung des Miteigentümers nicht zurechnen lassen und ihr steht folglich uneingeschränkter Versicherungsschutz zu.
Den Vorwurf der vorsätzlichen und auch der grob fahrlässigen Brandstiftung durch den Ehemann konnte also nur für dessen Eigentumsanteil von Bedeutung sein. Das Gericht hat den Vorwurf nach umfangreicher Beweiswürdigung als nicht bewiesen abgelehnt. Wenn auch einige einzelne Umstände „verdächtig“ wirkten, so genügte dies nicht, um den Anforderungen an den Vollbeweis zu genügen. Im Zivilprozess muss aus der Gesamtschau und Würdigung aller Indizien ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit erreicht werden, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (vgl. Hoenicke in Veith/Gräfe/Lange/Rogler, Der Versicherungsprozess, 5. Aufl. 2023, § 4 Rn. 343). Gerade das Fehlen dieser Gesamtwürdigung ist der häufigste Kritikpunkt des BGH an Berufungsurteilen im Zusammenhang mit vorsätzlichen Schadenstiftungen (Rintelen in: Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-Handbuch, 4. Aufl. 2025, § 28 Rn. 299). Im vorliegenden Fall hat das Gericht eine umfangreiche Beweiswürdigung vorgenommen und ist in nachvollziehbarer Weise zu dem Ergebnis gekommen, dass die Voraussetzungen einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Brandstiftung seitens des Ehemanns der Klägerin nicht ausreichend nachgewiesen wurden.
Es wird an diesem Fallbeispiel deutlich, dass die Urteilsfindung bei einer vermeintlich vorsätzlichen Brandstiftung immer eine Einzelfallentscheidung bleibt. Es können lediglich Anhaltspunkte und Orientierungshilfen durch vergleichbare Fälle und Entscheidungen gebildet werden. Und es zeigt sich, dass trotz Einschaltung mehrerer Sachverständiger der Nachweis vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Herbeiführung eines Brandschadenfalls für den Versicherer sehr schwierig sein kann.