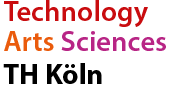Rückversicherung 2025 — Alles beim Alten?
Am 28. Mai 2025 fand die 21. Ausgabe des Kölner Rückversicherungs-Symposiums der TH Köln statt. Die ca. 490 teils internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten Interviews und Diskussionen insbesondere zu den Themen zeitgemäße Ausrichtung von Rückversicherungsunternehmen, verschiedene Aspekte des Rückversicherungsmarktes sowie Rückversicherung als Transformationsbegleiter. Unterstützt wurde das 21. Kölner Rückversicherungs-Symposium von Howden Re.
Eingangs berichtete Prof. Stefan Materne über die aktuellen Aktivitäten und Entwicklungen der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung. Dabei ging er insbesondere auf die diesjährigen Forschungsthemen der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein. Zusätzlich übernahm er die wissenschaftliche Einführung in die verschiedenen Gesprächsthemen des Tages.


Zu Beginn diskutierten Dr. Marc Surminski (Zeitschrift für Versicherungswesen) und Dr. Fabian Pütz (CEO Echo Re) über die Ausrichtung von Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Organisation, Prozessen, Nachwuchs, etc.. Dabei blickten sie zunächst auf einen möglichen Kulturwandel im (Rück-)Versicherungsgeschäft. Im Hinblick auf verschiedene Generationen im Managementbereich wollte Pütz unabhängig von Marktumständen keine pauschale Aussage treffen. Er wies drauf hin, dass es einerseits wichtig sei, zu hinterfragen, was dem primären Geschäftszweck diene und wie man seine Organisation ausrichte. Andererseits müsse man auch die die Teams in der Organisation umsichtig aufstellen. Pütz sieht die Branche als wenig hierarchisch, erkennt allerdings ebenfalls an, dass Erfahrung durchaus wertgeschätzt werde. Nach dem „Competition for Talent“ gefragt, merkte er an, dass er eine gewisse Erwartungshaltung in der jüngeren Generation spüre. Allerdings mahnte er ebenfalls zu mehr Geduld und betonte, dass beispielsweise eine Ausbildung zum Underwriter Zeit benötige. Es käme nicht nur darauf an, Tools richtig zu bedienen, sondern das gesamte Tätigkeitsfeld des Underwriters zu verinnerlichen. In diesem Zuge betonte Pütz ebenfalls, dass er einer 4-Tage Woche insbesondere zu Erneuerungsphasen kritisch gegenüberstehe. Dabei verkannte er jedoch nicht das Streben nach einer gesunden Work-Life-Balance. In Bezug auf die Echo Re betonte Pütz, dass es in Gesprächen mit jungen Kandidaten weniger um die individuelle fachliche Qualifikation gehe, als vielmehr, ein Gefühl für das Engagement und die Bereitschaft der jeweiligen Person zu bekommen.
Gefragt nach der Entwicklung der Digitalisierung in der Rückversicherungsbranche und deren Potenzial, stellte Pütz heraus, dass es primär darum gehe, zu identifizieren, wo Effizienzgewinne erzielt werden könnten. Seiner Ansicht nach sei die Branche noch sehr schlecht darin, strukturierte Daten effizient zu verarbeiten. Automatisierungspotential sieht er beispielsweise in dem Bereich Technical Accounting. Im Hinblick auf das Underwriting ist Pütz allerdings skeptisch. Er betonte, dass sich das über die Zeit gewachsene Geschäftsmodell, welches auf persönlichen Beziehungen basiere, als sehr resilient erwiesen habe. Eine allein durch künstliche Intelligenz herbeigeführte Underwriting-Entscheidung sei nicht erstrebenswert. Allerdings wies Pütz ebenfalls darauf hin, dass eine gezielte Unterstützung zum Beispiel bei Data Quality Checks oder der Dateneingabe wünschenswert sei. Dies würde dem Underwriter die Möglichkeit bieten, sich mehr mit seinen Kerngeschäftsthemen zu befassen.

Angesprochen auf die Prioritäten im derzeitigem Rückversicherungsgeschäft, hob er hervor, dass es momentan wichtig sei, die Organisation weiter aufzubauen und einen Fokus zu setzen. Dabei gehe es darum effizient zu wachsen, ohne top-line getrieben zu sein. Sollte der Markt nicht ausreichend sein, werde man sich in der Organisation auf die nächste Marktphase vorbereiten, anstatt weiter zu wachsen. In der Vergangenheit habe die Organisation das adäquatere Marktumfeld sehr stark genutzt, um die Nat Cat Exposure der Echo Re zu diversifizieren. Bei der DEVK Re habe eine Diversifizierung über die Line of Business im Mittelpunkt gestanden. Dadurch sei nominal nicht mehr Eigenkapital ins Risiko gestellt worden. In diesem Zuge verkannte Pütz nicht, dass auch Retrozession und andere Maßnahmen geeignet gewesen seien, um das Wachstum zu managen.
Anschließend befragte Prof. Stefan Materne (Direktor der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung) Christine Kaaz (Vorstandssprecherin NÜRNBERGER Allgemeine Versicherung) zum Thema Rückversicherung als Transformationsbegleiter von Versicherungsgesellschaften. Dabei wurde zunächst über Kaaz‘ Herausforderungen im Rückversicherungseinkauf bei der Ergo diskutiert bevor sie vor 10 Monaten zur NÜRNBERGER Allgemeine Versicherung (NÜRNBERGER) wechselte. Kaaz betonte, dass die Zentralisierung des Rückversicherungseinkaufs aufgrund der Strukturen des Gesamtkonzerns nicht einfach gewesen sei. Sie hob hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen Erst- und Rückversicherer (in diesem Fall vor allem Munich Re, aber auch anderweitige Rückversicherer) auch innerhalb eines Konzerns sehr komplex gewesen sei. Schließlich habe man die Herausforderung allerdings erfolgreich bewältigt und ein internes Rückversicherungsvehikel in Form einer risikotragenden Captive etabliert, über welches die Rückversicherung nun zentralisiert eingekauft werde. Für die Gesamtbeziehung zwischen Erst- und Rückversicherer sei es gemäß Kaaz wichtig, Zeit zu investieren und sich in die Rolle des Anderen hineinzuversetzen. Die Zeiten, in denen sich der Erstversicherer um den Vertrieb und die Basisschadenquote kümmere während der Rückversicherer sich um die Groß- und Cat-Schäden sorge, seien vorbei. Kaaz betonte, dass Rückversicherung für sie das Schweizer Taschenmesser der Erstversicherungsportfoliosteuerung sei.
Im Hinblick auf die Situation bei der NÜRNBERGER wies sie darauf hin, dass Rückversicherer von der momentanen, nicht ganz einfachen Situation profitieren würden. Dies sei nicht zuletzt auf die Rückversicherungsexpertise in der Vorstandsebene zurückzuführen. Zudem sei die Lösung in der Erstversicherung zu suchen, wenn das versicherungstechnische Ergebnis nicht stimme. Allerdings wies sie auf drei Aspekte hin, zu denen Rückversicherung aus ihrer Sicht eine bedeutende Rolle spiele. Erstens sei die NÜRNBERGER nach Verlusten im SHUK-Geschäft noch averser in Bezug auf Volatilität und Risiken geworden. Daher seien höhere Limite und niedrigere Selbstbehalte gekauft worden, soweit das Geld ausgereicht habe. Zweitens sei die Solvenzquote in Mitleidenschaft gezogen worden und Rückversicherung habe dabei als Optimierungswerkzeug geholfen. Drittens hätten sich Steuerungsmöglichkeiten bezüglich der Schwankungsrückstellungen mithilfe Rückversicherung geboten, mit Konsequenzen für das bilanzielle Ergebnis.
Auf die Frage nach den Gründen für die Krise bei der NÜRNBERGER wies Kaaz darauf hin, dass dieselben Gründe auch im gesamten deutschen Markt gegeben seien. Man habe zu spät auf die Inflation reagiert und die neue Frequenz bei den klimabedingten Naturgefahrenschäden nicht richtig eingeschätzt. Zudem seien hohe Pandemieschäden hinzugekommen. Dies habe in Kombination mit einem starken Wachstum der NÜRNBERGER insbesondere in der Türkei und Italien zur Krise der Organisation geführt. Indes betonte Kaaz ebenfalls, dass der deutsche Markt beispielsweise in der K-Sparte eine gute Reaktion gezeigt habe. In diesem Jahr trage sich der Markt wieder selbst und sei profitabel. Für die NÜRNBERGER sei es von großer Bedeutung zu einer ertragsbasierten Steuerung im Vertrieb überzugehen. Dies bedeute, dass man nicht nur in Wachstum investiere, sondern gleichzeitig Ertrag sicherstelle.
Angesprochen auf die Tatsache, dass viele Rückversicherer des Panels bei der NÜRNBERGER als Aktionäre auftreten, stellte Kaaz klar, dass es – wie bereits in der Vergangenheit – zu keinen versteckten Gewinnabführungen über Rückversicherung käme. Auch sei es nicht so, dass eine Verstärkung der Beziehung durch das Auftreten als Aktionär zwingend zu noch besserer Rückversicherung führe. Am Ende des Tages sei es von größter Bedeutung eine gemeinsame Strategie mit dem Rückversicherer zu entwickeln. Dabei käme es auch wesentlich darauf an, ob man langfristig einen ähnlichen Blick auf den Markt habe.

Die abschließende Paneldiskussion wurde von Herbert Fromme (Süddeutsche Zeitung, Versicherungsmonitor) geleitet, der die Teilnehmer in Anlehnung an das diesjährige Thema des 21. Kölner Rückversicherungs-Symposiums fragte, was sich in den letzten fünf Jahren in der Rückversicherungsbranche geändert habe. Thorsten Steinmann (Vorstandsvorsitzender der E+S Rück und Vorstand Hannover Rück) führte an, dass den Kunden der Wert von Rückversicherung noch bewusster sei als zuvor. Sabine Krummenerl (Vorstand Provinzial) nannte die Preispositionierung der Rückversicherer und den Kapazitätsbedarf der Erstversicherer.

Miguel Rosa (CEO Mapfre Re) machte keine großen Unterschiede aus. Er sehe eine große Stabilität in der Rückversicherungsbranche und bei den Schäden. Gefragt nach den ausgewiesenen Rekordgewinnen der Rückversicherer und der gleichzeitig schlechten Lage in den beiden Hauptsparten des deutschen Versicherungsmarktes (Kfz und Wohngebäude), wies Kummenerl darauf hin, dass Erstversicherer wieder eine stärkere Partizipation einfordern sollten. Man sehe zwar, dass die Rückversicherer in der Vergangenheit geleistet hätten und auf der Erstversicherungsseite gute Cat-Ergebnisse erzielt worden seien, die sich auf das Ergebnis der Rückversicherer auswirken. Allerdings führte sie ebenfalls an, dass für die Provinzial das Gleichgewicht im Markt verloren gegangen sei und man versuche, den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Steinmann äußerte Verständnis für die Perspektive der Erstversicherer und fügte hinzu, dass sich in den bisherigen Erneuerungsrunden des Jahres 2025 Indizien für eine Aufweichung in den verschiedenen Regionen feststellen ließen. Für die Hannover Rück befinde sich der Markt noch auf einem vertretbaren Niveau. Er hoffe nur, dass die Rückversicherungsindustrie das Pendel dieses Mal nicht wieder zu weit in Richtung Marktaufweichung ausschlagen lasse. Zudem wies er darauf hin, dass die Risikoträger in der Periode 2018-23 nicht ihre Kapitalkosten verdient hätten.
Rosa hob hervor, dass in den vergangenen Jahren der Ertrag für das übernommene Risiko nicht ausgereicht hätte. Beispielsweise in Europa sei es nun besser, schaue man jedoch auf die letzten vier Jahre, seien die Rückversicherer aufgrund der Secondary Perils (Elementargefahren) nicht profitabel gewesen. Gleichzeitig stellte er für den gesamten Rückversicherungsmarkt ähnlich wie Steinmann fest, dass der Markt aufweiche. Auf die Frage, ob sich das Verhältnis zwischen Erst- und Rückversicherer verändert habe, wies Rosa darauf hin, dass man sich stets in einer langfristigen Partnerschaft befinde und es normal sei, gemeinsam durch verschiedene Marktphasen zu gehen. Steinmann fügte hinzu, dass er insbesondere in der harten Marktphase positives Feedback von den Zedenten erhalten habe. Auch Krummenerl sieht keine Beschädigung des Verhältnisses zwischen Erst- und Rückversicherern. Diese würde lediglich eintreten, wenn es in einen unfairen Bereich abrutsche.
Im Hinblick auf die Frage, wer von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung profitiere, merkte Krummenerl an, dass die Erstversicherer die finale Entscheidungsgewalt hätten, welche Daten den Rückversichern präsentiert werden würden. Sie machte aus, dass Rückversicherer immer wissbegieriger werden würden, betonte aber gleichzeitig, dass einige Daten momentan nicht geliefert werden könnten. Steinmann merkte an, dass die Hannover Rück nicht nach Daten frage, die sie nicht verarbeite. Man müsse sich stets fragen, was man mit den Daten erzielen wolle. Rosa stimmte dem zu und betonte zugleich die Wichtigkeit der Daten für die Zukunft. Alle Panelisten waren sich einig, dass die künstliche Intelligenz im Underwriting eher eine Evolution als eine Revolution darstellen werde.
Nach Private Public Partnerships (PPP) im Bereich der Elementarversicherung gefragt, berichtete Rosa zunächst von dem spanischen Modell des Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), welches keine risikogerechten Prämien aufrufe, sich allerdings dennoch in der Vergangenheit bewährt habe. Sowohl Krummenerl als auch Steinmann sprachen sich jedoch dafür aus, dass in Deutschland auch bei einer Lösung, die den Staat einschließt, risikogerechte Prämien aufgerufen werden sollten. Krummenerl wies darauf hin, dass es den Dreiklang zwischen Versicherungsschutz, staatlicher Prävention und individueller Prävention brauche. Steinmann ergänzte, dass es für die Hannover Rück insbesondere darauf ankomme, in welcher Weise der gemäß Koalitionsvertrag intendierte staatliche Rückversicherer aktiv würde. So wäre ein staatlicher Stop Loss mit einer Wiederkehrperiode von 250 Jahren völlig in Ordnung. Alles was mit einer niedrigeren Priorität einsetze, würde hingegen kritisch gesehen. Darüber hinaus wurde über viele weitere Themen wie zum Beispiel ESG-Kriterien unter dem neuen amerikanischen Präsidenten oder Cyber-Herausforderungen diskutiert.
Für die stetig größer werdende Teilnehmerzahl aus dem internationalen Umfeld wurde auch in diesem Jahr eine englische Simultanübersetzung angeboten.Im Anschluss an das Symposium nutzten die Teilnehmenden bei dem Get-together die Gelegenheit für weitere Diskussionen und Networking.


Autor:
Erik Winkler
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung (Leitung: Prof. Stefan Materne) an der TH Köln